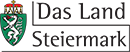Schlammbänke von Flüssen mit sommeranuellen Graumelde- und Zweizahngesellschaften
Charakteristische Arten
Gilb-Fuchschwanzgras, Nickender Zweizahn, Schwarzfrucht-Zweizahn, Dreiteiliger Zweizahn, Quellgras, Roter Gänsefuß, Ampfer-Knöterich, Kleiner Knöterich, Milder Knöterich, Kleines Flohkraut, Gefährlicher Hahnenfuß, Strand-Ampfer
Gefährdungsursachen
Veränderung der Pegeldynamik der Fließgewässer auf gleichbleibend niedrigem oder hohem Niveau (z.B. Stauhaltungen, Hochwasserschutzmaßnahmen); Wasserbautechnische Maßnahmen zur Laufbegradigung und Uferbefestigung; Umgestaltung von Flach- zu Steilufern und Uferbepflanzungen; Schadstoffeinträge und Abwassereinleitungen; Intensive Freizeitnutzung der Wasserwechselzonen und Uferbereiche;
Schutzstrategien
Gewährleistung der jahresperiodischen Wasserstandsdynamik; Minimierung der Nährstoff- und Schadstofflasten in den Gewässern; Erhaltung und Wiederherstellung von Ausuferungsbereichen und breiten Wasserwechselzonen;
Weitere Informationen
Pioniergesellschaften auf schlammigen Flussufern von naturnahen Fließgewässern. Geeignete Standorte befinden sich bevorzugt im Potamal der Flüsse an den regelmäßig überfluteten Uferbereichen zwischen dem mittleren Niedrigwasser und dem Hochwasser - dem so genannten Ripal. Die Strömungsgeschwindigkeiten sind in diesen Bereichen sehr gering, so dass es zur Sedimentation von feinen Partikeln (Sand, Schluff, Ton und organische Partikel) kommt. Dieser angelagerte „Schlamm" ist sehr nährstoffreich und weist häufig einen hohen Salzgehalt auf. Die Bodenreaktion ist überwiegend basisch.
Meist im Sommer tauchen die schlammigen Uferbänke nach dem Sinken des Wasserspiegels aus dem Wasser auf und bieten ein geeignetes, konkurrenzarmes Keimbett für die mastigen und hochwüchsigen sommerannuellen Pflanzenarten, welche überwiegend aus den Familien der Korbblütler (Asteraceae), Gänsefuß- (Chenopodiaceae) und Knöterichgewächse (Polygonaceae) stammen.
Der Lebensraumtyp dürfte zumindest ruderal beeinflusst sein, da er bevorzugt an Fließgewässern vorkommt, welche von Äckern und Wiesen umgeben, bzw. durch Abwassereinleitungen nährstoffreich sind (vgl. ELLENBERG 1986: 802). Viele der Pflanzenarten sind auch auf Ruderalstandorten weit verbreitet.
Verbreitung und Häufigkeit: Schwerpunktmäßig in der kontinentalen Region, besonders an den Flussläufen des südöstlichen Alpenvorlandes. In der alpinen Region besonders in größeren Flusstälern und am Ostrand der Zentralalpen, mäßig häufig; räumliche Ausprägung: kleinflächig - linear