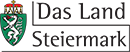Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontane auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
Charakteristische Arten
Bürstling, Arnika, Bleich-Segge, Färber-Ginster, Blutwurz, Bart-Glockenblume, Silikat-Glocken-Enzian, Berg-Nelkwurz, Gold-Fingerkraut, Höswurz
Gefährdungsursachen
Nutzungsaufgabe; Nutzungsintensivierung; Verbuschung oder Aufforstung; Düngung oder Nährstoffeintrag aus angrenzenden Flächen; Zerstörung von Beständen (Umwandlung in Ackerland, Anlage von Skipisten etc.); Änderung der Hydrologie bei (wechsel)feuchten Beständen (Grundwasserabsenkung, Entwässerung etc.); Verbauung;
Schutzstrategien
extensive Nutzung durch Beweidung oder Mahd; keine Düngung; Verbrachte sekundäre Bestände sollten wieder in Nutzung genommen werden; Bei stärker eutrophierten Flächen sollte in den ersten Jahren eine Aushagerungsmahd (1 x jährlich) erfolgen; keine Zerstörung von Beständen (Umwandlung in Ackerland etc.); Erfolgte Beeinträchtigungen der Hydrologie sollten rückgängig gemacht werden;
Weitere Informationen
In diesem Lebensraumtyp werden von niedrigwüchsigen Gräsern oder von Zwergsträuchern dominierte Bestände über sauren, nährstoffarmen Böden zusammengefasst. Die Standorte sind frisch bis mäßig trocken, seltener auch (wechsel)feucht. Die Höhenverbreitung reicht von der untermontanen (seltener kollinen) bis subalpinen Höhenstufe. Meist werden die Bestände vom namensgebenden Borstgras (Nardus stricta) dominiert, in einigen Ausprägungen können auch andere Gräser oder Zwergsträucher zur Dominanz gelangen. Die Bestände werden traditionell beweidet oder als einschürige Wiesen genutzt. Nur sehr wenige Bestände an der oberen Verbreitungsgrenze des Lebensraumtyps sind eventuell primär. Der Heuertrag liegt je nach Wüchsigkeit des Bestandes bei etwa 1.000-3.000 kg/ha/a.
Verbreitung und Häufigkeit: Hauptverbreitung in den Zentralalpen (auf Almen),auch auf Almen der Nördlichen und Südlichen Kalkalpen, selten im südostlichen Alpenvorland; in der alpinen Region häufig; räumliche Ausprägung: flächig.