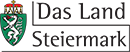Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald
Charakteristische Arten
Feld-Ahorn, Nessel-Glockenblume, Hainbuche, Schatten-Segge, Rotbuche, Verschiedenblättriger Schwingel, Wald-Labkraut, Leberblümchen, Frühlings-Platterbse, Nickendes Perlgras, Buntes Perlgras, Erdbeer-Fingerkraut, Vogel-Kirsche, Trauben-Eiche,
Gefährdungsursachen
Umwandlung der natürlichen Baumartenmischung; Aufgabe der traditionellen Nutzung (Nieder- und Mittelwaldwirtschaft); Invasion von standortsfremden (Baum-)Arten; Wildschäden; Rodungen für Bauland- oder Landwirtschaftsflächen; Schadstoffimmissionen; Klimawandel (z.B. Schwächung der Waldvegetation durch Extremereignisse wie Starkniederschläge, etc.)
Schutzstrategien
Förderung einer naturnahen Baumartenmischung; Förderung von Nieder- und Mittelwaldwirtschaft; Förderung einer abschnittsweisen Nutzung aneinander angrenzender Waldparzellen; Förderung von stehendem Totholz; Selektives Zurückdrängen von standortsfremden Arten; Wildstandsregulierungen;
Weitere Informationen
Dieser Lebensraumtyp fasst die mitteleuropäischen Eichen-Hainbuchenwälder auf eher trockenen Standorten zusammen. Es sind dies Laubmischwälder der planaren bis submontanen Höhenstufe Österreichs innerhalb des Buchenareals, welche aufgrund edaphischer bzw. klimatischer Verhältnisse für Buchenwälder nicht mehr geeignet sind. Die Baumschicht wird von Hainbuche und Eichen-Arten dominiert. Der Lebensraumtyp kommt auf wechseltrockenen bis mäßig trockenen Standorten vor. Die klimatischen Faktoren bedingen eine für die Rotbuche ungünstige Wasserbilanz aufgrund geringer Niederschläge, relativ hoher Temperaturen (hohe Verdunstung) und Gefährdung durchSpätfröste.
Die Bestände sind in ihrer Struktur stark von Nutzungen bestimmt. So werden bzw. wurden diese Wälder forstwirtschaftlich häufig als Niederwald oder Mittelwald genutzt. In der Niederwaldwirtschaft wird der gesamte Gehölzbestand für die Brennholzgewinnung in relativ kurzen Umtriebszeiten (ca. alle 30-60 Jahre) genutzt. In der Mittelwaldwirtschaft verbleiben einzelne Bäume für die Wertholzproduktion (Furniereichen), welche nach der dritten Umtriebszeit als Überhälter im Bestand stehen. Durch diese Bewirtschaftungsformen sind die Wälder reich strukturiert und ermöglichen eine große Artenvielfalt.
Verbreitung und Häufigkeit: Alpenostrand, westlicher Teil des südöstlichen Alpenvorlandes, zerstreut; räumliche Ausprägung: flächig.